Debattenbeitrag von Jürgen Betz und Erika Bock-Rosenthal
Veröffentlicht im Public Value Text des ORF:
Under Attack! Demokratischer Populismus und Madien
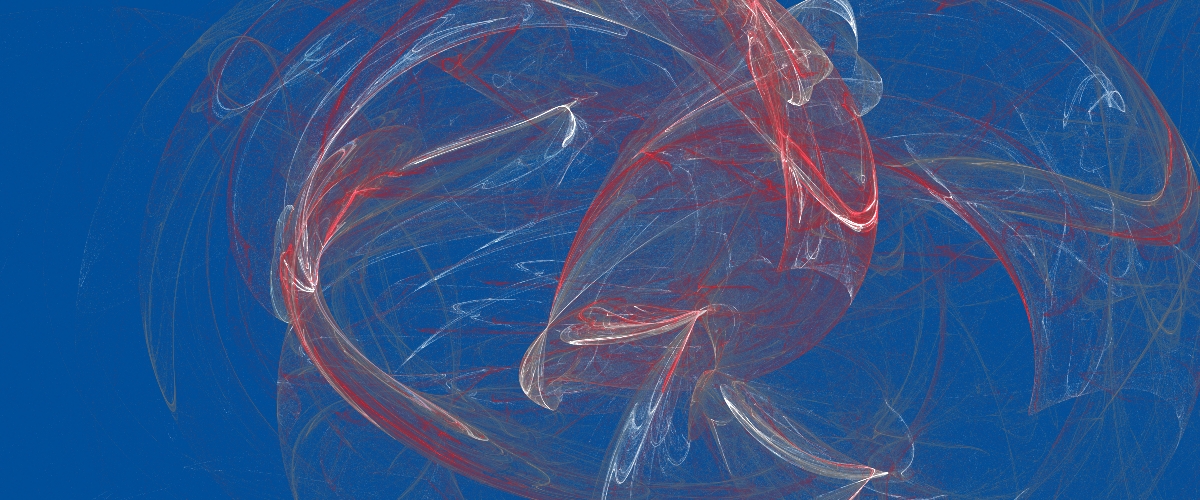
Berichte und Hinweise
Veröffentlicht im Public Value Text des ORF:
Under Attack! Demokratischer Populismus und Madien
Der reichste Mensch der Welt greift massiv und übergriffig in unseren Wahlkampf ein mit aller medialen Macht, die ihm zur Verfügung steht. Er postet ständig auf seiner eigenen Plattform X, deren Algorithmen ihn priorisieren und die AFD und andere Rechtsparteien in Europa bestmöglich bevorzugen. Auch Putin versucht, unseren Wahlkampf zu beeinflussen. Das Investigativ-Medium Correctiv fand geradeheraus, Russland betreibt 100 gefakte Nachrichtenseiten. Das chinesische Unternehmen TikTok wirkt als Radikalisierungsmaschine für Kinder und Jugendliche. Unter dem Banner einer vermeintlichen Meinungsfreiheit haben alle amerikanischen Digitalmilliardäre jegliche Verantwortung für die über ihre Dienste verbreiteten Inhalte fallen lassen. Es gibt keine Faktenchecks mehr, keinen Jugendschutz. Alle Dämme gegen Hass, Drohungen und Lügen sind gefallen. Hinzu kommt die Nutzung von KI als eine Technik, die täuschend echte Bilder produzieren und Stimmen manipulieren kann.
Wir haben dem Treiben der Tech- Milliardäre nichts entgegenzusetzen und sind auf deren Plattformen und Spielregeln angewiesen. Es gibt keine freien Märkte nur gut abgegrenzte Monopole. Unser Medienrecht passt nicht mehr. Die EU kommt mit dem Digital Services Act kaum hinterher, Verstöße gegen nationales Recht, gegen Selbstverpflichtungen und fehlende Transparenz zu ahnden. Es bleibt zu hoffen, dass die EU dem Druck aus den USA standhalten kann. Die Regeln zur politischen Online-Werbung greifen noch nicht, ebenso die Regelungen zur KI.
Medien haben in der Demokratie wichtige Funktionen. Ihre Beiträge zur politischen Meinungsbildung und zur Vielfaltsicherung haben, nach § 5 GG Verfassungsrang. Die Demokratie lebt vom Austausch der Informationen und Meinungen, von der Suche nach Wahrheit und nach vernünftigen Lösungen. Manipulationen, Fakes, Desinformationen, Propaganda und Drohungen sind Gift für unsere Demokratie.
Wie können Qualitätsmedien gestärkt werden, um Meinungsfreiheit und Vielfalt zu erhalten? Wir brauchen Erfindungen, die einen freien Markt eröffnen, ein breites gesellschaftliches Bündnis aller Medien, um eine eigene auch privat finanzierte europäische Plattform zu gründen. Das Institut für Europäisches Medienrecht hält Kooperationsformen zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Qualitätsmedien für zulässig. Das Bündnis Zukunft der Presse zielt in die gleiche Richtung. Wir brauchen kreatives Potenzial, Mut, private Investoren und die Unterstützung durch die Politik.
Notwendigkeit einer Neuausrichtung der Medienpolitik zum Schutz der Demokratie
Die fortschreitende Monopolisierung digitaler Kommunikationsplattformen und der zunehmende Einfluss globaler Technologiekonzerne stellen eine erhebliche Gefahr für demokratische Prozesse dar. Besonders besorgniserregend ist der Einfluss einzelner Digitalkonzerne auf öffentliche Meinungsbildung und politische Entscheidungsfindungen.
Ohne eine entschlossene Reform der Medienpolitik und eine strategische Neuausrichtung der digitalen Infrastruktur besteht die Gefahr, dass demokratische Prozesse weiter untergraben werden. Ein umfassendes Maßnahmenpaket zur Sicherstellung von Meinungsvielfalt, Qualitätspresse und Plattformunabhängigkeit ist daher dringend erforderlich. Für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk erwachsen daraus wichtige Aufgaben.
Prof. Dr. Erika Bock-Rosenthal, Gerhard Zienczyk
Wir betrauern eine engagiertes, kompetentes und höchst liebenswertes Mitglied des Initiativkreises öffentlich-rechtlicher Rundfunk in Köln.
Vor einigen Jahren wurde Herrn Eckhardt der Weg zu unseren Sitzungen zu mühsam, aber unsere Debatten hat er aus der Ferne aufmerksam mitverfolgt. Integration und kulturelle Vielfalt waren ihm ein Herzensanliegen. Wenn er sich in Debatten oder im persönlichen Gespräch zu Wort meldete, bereicherte er den Diskurs durch Argumente, die er aus seinem breiten Erfahrungsschatz schöpfte.
Der IÖR wird ihm ein würdiges Andenken bewahren.
Die Ziele des Reformpakets der Rundfunkkommission der Länder, insbesondere die öffentlich-rechtlichen Medien zu stärken und ihre Weiterentwicklung zu fördern, sind zu begrüßen. Einige, der vorgeschlagenen Regelungen aber sind geradezu konträr zu den mit dem Reformpaket verfolgten Zielen.
Der Initiativkreis öffentlich-rechtlicher Rundfunk Köln. e.V. (IÖR) begrüßt das Vorhaben, die öffentlich-rechtlichen Medien zu stärken und ihre Weiterentwicklung zu ermöglichen. Mit dem Entwurf nehmen die Länder ihre Aufgabe ernst, Auftrag und Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Angebots zu regeln und zu konkretisieren. Diese Aufgabe ist Sache des Gesetzgebers, wie das BVerfG mehrfach klargestellt hat.
Allerdings dürfen diese medienpolitischen Entscheidungen und die Entscheidung über die Finanzausstattung von ARD, ZDF und DLR nicht miteinander verknüpft werden, wie das BVerfG wiederholt entschieden hat. Der Grundsatz der Trennung zwischen der allgemeinen Rundfunkgesetzgebung, wozu der der Reformstaatsvertrag gehört, und der Festsetzung des Rundfunkbeitrags soll Risiken einer mittelbaren Einflussnahme auf die Wahrnehmung des Programmauftrags ausschließen und damit die Programmfreiheit der Rundfunkanstalten sichern.
Besonders kritisch ist, dass die Regelung der Finanzierung des ÖRR in eine ungewisse Zukunft verschoben wird. Wie soll denn der erbetene Reformeifer der Anstalten geweckt werden, wenn ihnen die durch die KEF festgestellten notwendigen Finanzmittel verfassungswidrig verweigert werden und die Anstalten deshalb gezwungen werden, über Gebühr Einsparungen vorzunehmen. Qualitätsverbesserungen anzumahnen und gleichzeitig zum übermäßigen Sparen zu zwingen ist ein Widerspruch in sich!
Der bewusste Verzicht auf eine Entscheidung über die von der KEF empfohlene Beitragserhöhung um 58 Cent ab 2025 ist mit Blick auf die Entscheidung des BVerfG vom 20.7.2021 verfassungsrechtlich unzulässig, zumal den Ländern – wie Aussagen von Frau Raab bei DWDL vom 30.9. und Herrn Haseloff in der FAZ vom 1.10.2024 zeigen – bewusst ist, dass die mit dem Reformstaatsvertrag verbundenen Einsparungen frühestens in 2028-2029 wirksam werden, also den aktuellen, von der KEF festgestellten Finanzbedarf nicht reduzieren.
Die Länder sind als föderale Verantwortungsgemeinschaft zur angemessenen Finanzierung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten verpflichtet und können den Vorschlag der KEF nicht einfach ignorieren, wie das BVerfG klar und deutlich festgestellt hat. Wenn ihnen der öffentlich-rechtliche Rundfunk wirklich wichtig ist, sollten die Länder nicht weiter eine monatliche Beitragserhöhung ab 2025 um den Preis eines Brötchens verweigern, sondern viel mehr der Bevölkerung vermitteln, dass diese für 60 Cent am Tag ein sehr breites, vielfältiges und für unsere Demokratie wichtiges Gesamtangebot der Rundfunkanstalten erhält.
Dann wären auch moderate, nicht einmal die Inflation ausgleichende Anpassungen wie der aktuelle KEF-Vorschlag von 58 Cent fest für 4 Jahre den Bürgerinnen und Bürgern leichter verständlich und akzeptabel zu machen, die ganz andere Preissteigerungen auf vielen Gebieten, gerade auch der Daseinsvorsorge, hinnehmen müssen
Die Konkretisierung des Auftrags mit Blick auf die Stärkung der Interaktion und Partizipation ist grundsätzlich zu begrüßen. Partnerschaften mit Bildungs- und Kultureinrichtungen, insbesondere mit öffentlich-rechtlichen Institutionen sind auch zur Stärkung der Demokratie in einer hochgradig vernetzten Welt sehr wichtig. Deshalb sollte hier ein klargestellt werden, dass die gemeinsame Plattform auch für Partner und für jegliche Kooperationen genutzt werden kann. Dass der Gesellschaftsdialog auf vielen Ebenen und in unterschiedlichen Formaten verstärkt werden soll, ist sehr sinnvoll. Er wird allerdings mit sehr differenzierten quantitativen Leistungsanalysen gleich eingehegt. Hier wäre mehr Freiheit zum Ausprobieren wünschenswert. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass auch qualitative Leistungsanalysen notwendig sind, und insbesondere Wirkungsstudien nur mit wissenschaftlicher Begleitung erfolgen können.
Die Gremien bekommen in diesem Zusammenhang auch eine neue Verantwortung, denn sie geben Leistungsanalysen in Auftrag und werten Sie aus. Sie werden auch am Gesellschaftsdialog teilhaben. Dazu müssen ihnen die Mittel bereitgestellt werden. Letztendlich tragen die Gremien in all den vorgeschlagenen Umstrukturierungen große Verantwortung.
Zum Medienrat sind zumindest einige kritische Fragen anzubringen. Offenbar besteht die Hoffnung, die Kontrolle über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk an eine kleine Expertengruppe abgeben zu können. Wollen sich die Länder ihrer Verantwortung für den öffentlich-rechtlichen Mediensektor entziehen?
Ein Medienrat, der über allem schwebt, soll nach Auskunft von Frau Raab den Kontakt zu den Menschen halten, um von außen zu erschließen, ob die Angebote bedarfsgerecht sind. Das aber ist doch eine Aufgabe des Gesellschaftsdialogs. Bei der vorgesehenen Berufung der Mitglieder würde es sicher politisch nicht einfach sein, bei der Berufung alle Fachrichtungen zu berücksichtigen, die Ost-West-Balance einzuhalten und Gendervorgaben zu erfüllen. Wenn die vorhandenen Kontrollgremien angemessen ausgestattet werden, ist kein Zusätzliches Gremium nötig.
Der Titel „Schwerpunktangebote“ verschleiert für interessierte Laien, dass es hier um die Schließung von Programmen und Kanälen geht im Rahmen von Einsparmaßnahmen. Da sollen Ressourcen gebündelt und überführt werden. Rhetorisch wird betont, dass man statt Quantität mehr Qualität erreichen möchte. Wieso denn gerade bei den Qualitätssendern wie 3Sat und Kika und Phoenix gespart werden soll, erschließt sich nicht, zumal es hier essenziell um Vielfaltssicherung geht. Zudem sind die zu erwartenden Einsparungsmöglichkeiten nicht sehr groß.
Wenn die öffentlich-rechtlichen Angebote in den Bereichen Bildung, Dokumentation und Information gestärkt werden sollen – was in diesen Zeiten dringend nötig ist – muss man die Sender in diesen Bereichen nicht mit gewaltigen jahrelangen Umorganisationen beschäftigen und womöglich lahmlegen. Schon die Bildung von „Körben“, in denen sich nur Informationsspartenkanäle, oder nur Bildungsangebote befinden, die untereinander konkurrieren, widerspricht der offiziellen Rhetorik der Qualitätssicherung und der grundgesetzlichen Vielfaltsicherung. Da macht es keinen Sinn ausgerechnet hier Einsparungen vornehmen zu wollen.
Die beabsichtigte Begrenzung der Spartenprogramme widerspricht dem Kultur- und Bildungsauftrag des ÖRR. Gerade in Zeiten von fake news und Verschwörungsinhalten ist es kontraproduktiv, das Informationsangebot des ÖRR, das unterschiedliche Zielgruppen anspricht, in der vorgesehenen Weise zu beschneiden.
Eine Integration von 3Sat in ARTE, wie sie ermöglicht werden soll, allerdings nicht verpflichtend ist, erscheint nicht sinnvoll. Die Länder haben immer wieder den kulturellen Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks hervorgehoben. Dies kommt z.B. bereits in § 26 Absatz 1 und nun auch in § 26a Absatz 4 Ziff. 5 des Entwurfs erneut zum Ausdruck. Mit den beiden Programmen wird der Kultur- und Bildungsauftrag bislang in besonderer und guter Weise erfüllt. Daher sollten die beiden Programme 3Sat und ARTE weiterhin jeweils explizit beauftragt und § 28a Absatz 1 Satz 2 gestrichen werden. Zumindest sollte in Satz 2 das Wort „sollen“, durch „können“ ersetzt werden.
In diesen Zeiten ausgerechnet die demokratierelevanten Informationskanäle zu fusionieren ist hoch problematisch. Das widerspricht der verfassungsmäßig gebotenen Vielfaltsicherung. Angesichts der Notwendigkeit zur Aufdeckung von Falschmeldungen, der immer umfangreicheren Berichterstattung aus den Krisen der Welt und der schwierigen politischen Gemengelage in Deutschland, sind wirklich vielfältige Zugänge wichtig! Phoenix ist der einzige Sender, der Parteitage oder Plenarsitzungen in voller Länge präsentiert. Das sind manchmal Sternstunden politischer Bildung. Außerdem: wie sollte eine Fusionierung an vier Standorten verlaufen in Mainz, Hamburg, Bonn und München? Allenfalls könnten ZDF info und tagesschau 24 fusionieren, aber da sind wir im Kern des Verfassungsauftrages der Vielfalt, der es ermöglichen soll, bei wichtigen Ereignissen von einem zum anderen Sender zu wechseln.
Sinnvoll allerdings sind die Vorschläge, die Kinderangebote nach Altersklassen noch zielgenauer einzurichten und vor allem den Versuch zu unternehmen, junge Menschen besser zu erreichen. KI.KA weist jetzt den größeren Kindern schon den Weg ins Internet, muss aber als Marke bleiben, um besser auffindbar zu sein.
In der Erläuterung zu Absatz 3 werden die Programme ZDFneo und ARD ONE als Programme für Menschen über 30 Jahre erwähnt. Nach Absatz 3 Ziff. 3 sollen ARD und ZDF ein Programm für jüngere Erwachsene gestalten, wobei offenbar an eine Fusion von ZDFneo und ARD ONE gedacht wird. Hier sollte eine stärkere Konkretisierung der inhaltlichen Erwartungen der Länder an ein Programm für Menschen über 30 Jahre erfolgen, denn ARD ONE und ZDFneo bestehen, betrachtet man die Programminhalte einmal über den Zeitraum von einem Monat näher, zu über 90% aus reinen Wiederholungen und sind Abspielkanäle von bereits im Ersten oder Zweiten gesendeten Beiträgen.
Beide Programme haben nichts mehr mit den guten, gerade auf jüngere Menschen zugeschnittenen Programmkonzepten und -profilen zu tun, die ARD und ZDF 2009 zum 12. Rundfunkänderungs-StV vorgelegt haben und die eigentlich auch rechtlich verpflichtend sind, aber seit Langem nicht erfüllt werden. Beide Programme sind in ihrer heutigen Gestaltung verzichtbar. Sie entsprechen allenfalls in einem Umfang von 10 % einem Programm, das sich vom Ersten und Zweiten unterscheidet. Ein Programm für Menschen ab 30 Jahren sind beide nicht und deshalb macht es auch keinen Sinn, diese Programme zu fusionieren, wenn sie nicht mit einem klaren Auftrag der Länder verbunden werden.
Eine gemäß §28a Absatz 4 vorgesehene datumsmäßig verpflichtende Überführung der in Absatz 2 und 3 genannten Programme ab 1.1.2033 ins Internet (als Telemedienangebote) erscheint nicht sinnvoll. Die Worte „spätestens jedoch zum 1.1.2033“ sollten gestrichen werden, da heute nicht schon absehbar ist, ob bis dahin die lineare Nutzung nur noch marginal ist.
Die Reduzierung der Zahl der von ARD bislang veranstalteten über 60 Hörfunkprogramme erscheint nachvollziehbar. Vor allem Programme gleicher Musikfarbe können durch Kooperation zusammengelegt werden.
Es fehlt allerdings an einer Konkretisierung der Inhalte der Hörfunkprogramme. Die Reduzierung der Anzahl darf nicht dazu führen, dass Hörfunkprogramme mit den Inhalten Information, Bildung und Kultur künftig zugunsten von Unterhaltungsprogrammen entfallen. Daher sollte in Absatz 1 nach Satz 1 eingefügt werden: „Die Hörfunkprogramme dienen insbesondere der Information, der Bildung und der Kultur.“
Es ist sehr zu begrüßen, dass eine allgemeine Plattform für alle öffentlich-rechtlichen Angebote ermöglicht wird. Um ein Gegengewicht zu den amerikanischen Großunternehmen zu schaffen, sollte aber perspektivisch eine Public-Service-Plattform angestrebt werden, die auch Kultur- und Wissenschaftseinrichtungen beteiligt Es geht hier darum, die Demokratie vor medialen Autokraten zu schützen.
Der Umbruch der Medienlandschaft wird sich nach aller Voraussicht in den nächsten Jahren beschleunigt fortsetzen. Ohne Gegenmaßnahmen werden sich herkömmlichen Medien im „Plattformisierungsprozess“ weder ökonomisch noch publizistisch behaupten können. Warum also – wenigstens als Gegengewicht – nicht eine öffentliche, beitragsfinanzierte Plattform? Vielleicht auch unter Beteiligung von Verlagen und Kultur- sowie Wissenschaftseinrichtungen.
Deshalb wird vorgeschlagen:
Eine Public-Service-Plattform hätte beispielhaft folgende Vorteile:
Die Verschärfung des Verbots der Presseähnlichkeit der Angebote des ÖRR im Internet ist abzulehnen. Das Verbot widerspricht in besonderem Maße dem Auftrag des ÖRR, alle gesellschaftlichen Gruppen zu erreichen. Gerade unter jüngeren Menschen spielen die online Angebote zu politischen Themen eine immer größere Rolle. Es ist daher kontraproduktiv, öffentlich-rechtliche Textangebote einzuschränken und Nutzungsgewohnheiten dieses Publikums zu missachten.
Hinzu kommt, dass der Begriff der Presseähnlichkeit schon immer schillernd und zu unkonkret ist. Vor allem aber passt das Verbot nicht mehr in unsere Zeit. Gerade in Zeiten von Fakenews, massiver Beeinflussung der Meinungsbildung durch das Internet ist es abwegig, Textangebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunk noch mehr als bisher für unzulässig zu erklären. Sie dienen gerade auch der seriösen und zuverlässigen Information und gehören inzwischen durch die veränderte Mediennutzung zum Grundversorgungsauftrag, wie der frühere Präsident des BVerfG, Hans-Jürgen Papier, schon 2010 im Gutachten „Zur Abgrenzung und Auslegung des Begriffs der Presseähnlichkeit“ festgestellt hat.
Wie die aktuelle eco-Umfrage zeigt, informieren sich immer mehr Menschen über politische Themen über das Internet. Online-Angebote sind also bei der politischen Meinungsbildung immer relevanter und spielen eine entscheidende Rolle. Es ist daher absurd, Texte auf öffentlich-rechtlichen Angeboten derart einzuschränken, während private Online-Angebote längst crossmedial und voll mit Video- und Audioinhalten sind. Insbesondere, um junge Menschen zu erreichen, muss man auf ihre Lesegewohnheiten eingehen.
Zum anderen ist das Ziel, mit diesem Verbot die Presse zu schützen, nicht zu erreichen. Es gibt keinen Beweis dafür, dass die Textangebote von ARD, ZDF und DLR die Wirtschaftlichkeit der Presse und ihrer Onlineangebote tangieren. Vorliegende Gutachten belegen das Gegenteil. Dass der BDZV ohne Belege etwas anderes behauptet, darf die Länder nicht zu der vorgesehenen Regelung veranlassen. Es besteht auch kein Grund, vor der EU-Kommission wegen des laufenden Verfahrens einzuknicken. Das Verbot der Presseähnlichkeit darf nicht noch verschärft werden; es gehört ganz gestrichen-
Der hohe Gesamtaufwand für Sportübertragungen sollte insgesamt begrenzt werden. Neben den Sportrechtekosten fallen auch hohe weitere Kosten für Produktion, Technik, Personal, Honorare sowie Gemeinkosten bei Sportsendungen an. Daher erscheint eine auch prozentmäßige Begrenzung auf maximal 10 % sinnvoll und erforderlich, da diese Kosten seit Jahren ständig ansteigen. Deshalb sollte in Satz 1 hinter dem Wort „Mittel“ in Klammern eingefügt werden „(Vollkosten)“. Diesen Begriff verwendet auch die KEF.
Dass die Sender nicht ganz ehrlich mit ihren tatsächlichen Sportkosten umgehen, zeigen die aktuellen Berichte über Differenzen bei den Angaben der Sportkosten des ZDF (siehe epd medien vom 4.10.2024 „Ein Sender zwei Zahlen“). Während das ZDF die durchschnittlichen Kosten im Zeitraum 2020-2023 mit 207 Mio. € p.a. angibt, weist die KEF allein für 2022 die Kosten für den Bereich Sport beim ZDF mit 354,5 Mio.€ aus.
Sofern der eingeklammerte Satz 2 bestehen bleibt, sollten aus dem gleichen Grund die Worte „Aufwand für den Erwerb von Übertragungsrechten für Sportereignisse“ durch „Aufwand (Vollkosten) für die Produktion und Ausstrahlung von Sportereignissen“ ersetzt werden.
Es ist zu begrüßen, dass der bislang konturen- und weitgehend inhaltslose ARD-Staatsvertrag nun deutlich erweitert und Konkretisierungen der Zusammenarbeit der Landesrundfunkanstalten und der Gremienkompetenzen vorgenommen werden. Auch die verstärkte Zusammenarbeit mit ZDF und DLR (§3 Absatz 2) ist sinnvoll.
Das schon lange in der ARD geübte Federführungsprinzip hat den Nachteil, dass Federführer nur Vorschläge machen können, die dann von den anderen Anstalten angenommen werden können oder auch nicht. Es hat daher bislang keine rechtliche Verbindlichkeit und hat nicht zum relevanten Abbau von Mehrfachstrukturen geführt. Insofern ist zu begrüßen, dass es jetzt staatsvertraglich verankert und eine Verpflichtung zur Nutzung der durch die federführende Anstalt erbrachten Leistungen vorgeschrieben wird. Nur so macht ein Federführungsprinzip Sinn.
Die Vorsitzzeit wird nun auf 2Jahre festgelegt, dem bisher üblichen Zeitraum. Ob die Festlegung von 2 stellvertretenden Anstalten sinnvoll ist, erscheint fraglich. Es erscheint sinnvoller, den Zeitraum auf 4 Jahre festzulegen, da damit vermieden wird, das immer wieder Einarbeitungszeiten und auch personeller und Sachaufwand bei Übernahme des Vorsitzes entstehen, wie dies bislang der Fall ist. Im Übrigen lassen sich in 2 Jahren nur wenig substantielle Ziele des Vorsitzes umsetzen, wie die Vergangenheit gelehrt hat.
Für das in Absatz 3 genannte gemeinsame Büro sollte geregelt werden, dass dieses mit angemessenen personellen und finanziellen Ressourcen ausgestattet wird, so wie dies für die Gremienbüros der Landesrundfunkanstalten vorgeschrieben ist.
Die Bestimmung über die Gremienvorsitzendenkonferenz (GVK) ist sinnvoll, weil sie eine bislang bestehende Lücke im ARD-Staatsvertrag schließt und der GVK nun eine eigene Zuständigkeit verschafft, die sie bisher nicht besitzt.
Nach der vorgesehenen Regelung soll sie allerdings nur beratende Funktion und keine Entscheidungskompetenz erhalten, was ihre Funktion weiterhin schwächt. So hat der bisherige „Programmbeirat Erstes Deutsches Fernsehen“ auch nur eine beratende Rolle und seine Beratung hat seit jeher nur eine außerordentlich bescheidende Wirkung auf den Inhalt des Ersten.
Wenn die GVK auch auf den Inhalt der gemeinschaftlichen Angebote der ARD und deren Finanzierung haben soll, benötigt die GVK hierfür eine konkrete Kompetenz bzgl. der Verwendung der von den Landesrundfunkanstalten im Rahmen ihrer von den Rundfunkräten genehmigten Etats für die gemeinschaftlichen Angebote zur Verfügung gestellten Finanzmittel. So wie die Rundfunkräte der ARD-Anstalten über die Etats ihrer Anstalt entscheiden und z.B. Etatansätze des Intendanten ändern können (etwa mehr Mittel für Dokumentationen als für Krimis festlegen), sollte auch die GVK eine entsprechende Kompetenz für die Verwendung der für die gemeinschaftlichen Angebote zur Verfügung stehenden Mittel erhalten. Nur dann kann die GVK den Einfluss nehmen, den die Rundfunkräte der ARD-Anstalten schon immer auf den Etat ihrer jeweiligen Anstalt haben. Derzeit entscheiden über die Inhalte und die konkrete, genrebezogene Mittelverwendung der gemeinschaftlichen Angebote keine Gremien, sondern für das Erste und die ARD-Mediathek die Programmdirektorin Erstes Deutsches Fernsehen und für die anderen gemeinschaftlichen Angebote die Exekutive der für das Angebot zuständigen Anstalt, nicht deren Gremien.
Da die Länder im 3. MedÄStV die Kompetenzen der Gremien bewusst gestärkt haben, sollte auch für die Inhalte und die Mittelverwendung für die gemeinschaftlichen Angebote eine Gremien-Entscheidungskompetenz geschaffen werden, dafür eignet sich die GVK. Nur dann können auch die Qualitätsrichtlinien (§ 31 Absatz 4 MedStV) wirksam kontrolliert umgesetzt werden. Daher sollte in § 8 nach Absatz 1 folgender neuer Absatz eingefügt werden:
„Die Gremienvorsitzendenkonferenz beschließt über die genrebezogene Mittelverwendung der von den Landesrundfunkanstalten für die gemeinschaftlichen Angebote zur Verfügung gestellten Finanzmittel.“
Mit dieser Formulierung bleiben die Kompetenzen und Zuständigkeiten der Gremien der ARD-Anstalten unberührt.
Hier wäre zu überlegen, ob in Absatz 1 nicht besser die GVK als Aufsichtsinstanz vorzusehen ist als die Gremien der geschäftsführenden Anstalt, die ja nach dem Entwurf alle 2 Jahre wechseln.
Das ZDF hat bisher eine reine Intendantenverfassung, daher ist es zu begrüßen, dass im Entwurf ein Direktorium vorgesehen ist. Die Regelungen dazu sind allerdings sehr kleinteilig und bürokratisch.
Drei Nachrufe auf die entschiedene Kämpferin für die Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
WEITER ☞Der Initiativkreis öffentlich-rechtlicher Rundfunk Köln (IÖR) fordert in einer „Stellungnahme zur aktuellen Medienpolitik der Länder und wie der öffentlich-rechtlichte Rundfunk auf die Gefährdung unsere Demokratie reagieren sollte“ die Länder auf, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als tragende Säule des Mediensystems zu stärken und seine verfassungsgemäße Finanzierung zu gewährleisten. Zugleich empfiehlt der Verein den Sendern, mehr Public-Value-Angebote zu machen, um einen Beitrag zur Stärkung der Demokratie zu leisten.
WEITER ☞von Wolfgang Lieb
Seit 1989, als Tim Berners-Lee das World Wide Web erfunden hat, erleben wir einen grundlegenden Wandel des Mediensystems, der in seiner Qualität eigentlich nur noch mit der Erfindung des Buchdrucks zu vergleichen ist.
Zwar weichen die Angaben über die Mediennutzung, über die Reichweite und über die Wirkung der einzelnen Medien je nach Untersuchung deutlich voneinander ab, aber die Tendenz ist eindeutig: Vor allem, wenn man auf die nachfolgenden Generationen schaut, verlieren die klassischen Medien, insbesondere die Zeitungen, aber auch das programmgebundene, lineare Radio und das das öffentlich-rechtliche wie das private Fernsehen dramatisch an Bedeutung, zumal für die Verbreitung von Informationen, während das Medium Internet als Kommunikationsplattform sowohl im Hinblick auf
ja inzwischen sogar die Führungsrolle übernommen hat.
WEITER ☞Nachdem kürzlich inoffiziell bekannt wurde, dass die KEF vermutlich eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags von 58 Cent vorschlagen könnte, konterten viele Ministerpräsidenten umgehend, dass für sie nur „Beitragsstabilität“ in Frage käme. Schon bevor die KEF überhaupt an Ihre Arbeit ging, verkündeten mehrere Ministerpräsidenten, man wolle auf keinen Fall eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags zulassen. Das kann man auch als den Versuch der Einflussnahme auf eine verfassungsgemäß unabhängige Einrichtung interpretieren. Schon vor dem KEF-Vorschlag eine Beitragsanhebung auszuschließen war offensichtlich verfassungswidrig.
Vollständiger Text der Stellungnahme des Initiativkreises bei medienpolitik.net
von Wolfgang Lieb
Es kann nicht sein, dass die Medienpolitik ausgerechnet bei der dringend notwendigen Reform der ö/r Anstalten, die wir für den Erhalt und die Förderung unserer Demokratie als essentiell erachten, einen Dialog auf Augenhöhe mit Programm- und Medienmacher*innen für überflüssig hält.
Als breite Allianz aus Medienschaffenden und zivilgesellschaftlichen Kräften können wir konstruktive und kritische Unterstützung leisten, ohne die eine Reform der Anstalten kaum gelingen kann. Das geschieht nicht in Konkurrenz zu dem jüngst eingesetzten „Zukunftsrat“, sondern diesen ergänzend.
Wir sind überzeugt: Unsere ö/r Medien werden nur auf einer breiten Legitimationsbasis bestehen können. Daher wollen wir diesen Prozess gemeinsam verbessern und verstetigen.
Im Mai 2023 haben wir uns mit einem Offenen Brief (als pdf zum Download) an alle Mitglieder der Rundfunkkommission gewandt, um hier endlich einen Schritt weiterzukommen.
WEITER ☞